| Inhalt 2010 - 2012 | Home |
Xavier Xanten, 1986, Hamburg

Flügel aus Glas
Unser Schweigen ist längst eine eigene Sprache.
Ich setze mich neben sie und stelle die Schultasche zwischen meine Füße. Ich frage mich, ob ich den Geruch von Regen mitbringe, den Duft der Wolken und ob es besser gewesen wäre, einen Schirm mitzunehmen. Mein Blick streift sie nur kurz, ich will sie nicht anstarren. Ihre langen, braunen Haare sind dunkler als sonst und strähnig, ihr Gesicht sehe ich nicht, sie blickt aus dem Fenster.
Ich weiß, dass sie Antonia heißt, obwohl sie es mir nie gesagt hat.
Ihre Mutter hat es mir verraten. Und sie hat gesagt: »Pass gut auf sie auf, bitte, bitte.« Ich hab damals gedacht, ich fahre den Bus doch gar nicht. Das macht der da vorne, am Steuer und er bleibt immer auf der Straße, seit vielen Jahren und ist niemals abgehoben. Das denkt Antonia sicherlich jetzt, während sie die Regentropfen am Fenster zählt.
Ich weiß noch genau, wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Ich stieg aus dem Bus, musste an dem Tag irgendeine Klausur schreiben, meine Gedanken passten nicht zu den Bildern, die ich sah.
Es war ein schöner Tag gewesen, einer, an dem man den Mond noch bis lange in den Tag hinein beobachten konnte. Als blasse Sichel, die das schwache Blau des Himmels nicht verdecke konnte.
Alle waren ausgestiegen und sie blieb einfach sitzen, Antonia. Ganz alleine, alle Fensterplätze für sich. Sie hatte nach draußen gesehen, vielleicht leise gelacht, weil alle an der falschen Seite des Glases waren und niemand sie festhalten konnte.
Ihre Hände liegen auf dem Schoß, ganz ruhig liegen sie da, wie Schmetterlinge, die sich ausruhen müssen. Immer noch sieht sie aus dem Fenster, obwohl wir so schnell fahren, dass man da keine Bäume mehr am Straßenrand sieht, sondern nur noch einen grünen Farbstreifen. Sie hat mir den Fensterplatz weggenommen, gleich am ersten Tag.
Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt nicht mehr träumen kann, aber meine Träume handeln nun eben von weit entfernten Orten. Von denen ich nicht einmal weiß, ob es sie wirklich gibt.
Nur manchmal, so wie heute, denke ich nach, über Antonia und dass sie doch eigentlich ziemlich seltsam ist. Sie ist dran mit reden, ich hab den Anfang gemacht, hab ihr gesagt: »Hallo, ich bin Luis.«
Gleich am ersten Tag und jetzt ist sie dran. Viele Wochen zu spät, aber das wäre nicht so schlimm, wenn sie nur bald anfangen würde.
Bestimmt hat sie zu Hause gesagt:
»Glaub mir, Mama, der Bus ist einfach weitergefahren. Er hat vergessen, dass er ein Schulbus ist und ist weitergefahren, einfach so. Wie ein Glasgefängnis.« Und Mama hat bestimmt genickt und sie in den Arm genommen.
Am nächsten Tag hat sie dann an der Bushaltestelle gewartet, Antonia an der Hand und mich irgendwann ganz leise gefragt:
»Kannst du auf sie aufpassen? Bitte, bitte.« Ich habe Antonia angesehen, ganz kurz natürlich nur.
Ich meinte es gar nicht so, als ich sagte: »Weiß nicht«, aber da kam der Bus auch schon und ihre Augen bedankten sich bereits und ihre Hände schoben mir die ganze Verantwortung zu. Ich habe Antonias Hand sofort wieder losgelassen. Damit niemand denkt, wir wären ein Paar und ich es niemanden erklären brauchte. Sie ist ja auch viel jünger als ich. Wir sind eingestiegen, was hätte ich denn anderes tun sollen?
Sie schaut jetzt geradeaus. Ihre Augen kann ich immer noch nicht sehen, aber sie sind sehr dunkel. Braun, vielleicht schwarz. Sie spiegeln sich im Fenster, deswegen weiß ich das. Ich schaue ja auch immer raus.
Manchmal wünsche ich mir, dass sie ein Buch ist. Damit ich sie in Ruhe ansehen und ein Lesezeichen in die Stellen legen kann, die mir am besten gefallen haben. Dann schimpfe ich immer mit mir selbst. Menschen, Bücher, Lesezeichen, also so was Blödes hab ich ja noch nie gehört. Und: Lies doch ihre Augen.
Ihre Augen glänzen immer, heute so wie gestern. Entweder weint sie immer oder nie. Ich würde es wirklich gerne wissen.
Überhaupt will ich, dass sie mir erzählt.
Ich sag es auch nicht weiter, kein Problem. Sie soll mit mir reden, als wäre ich weites Land, das dafür sorgt, dass niemand anderes zuhört. Sie soll erzählen, dass sie gerade zehn geworden ist und adoptiert wurde. Dass sie einen Wellensittich hat, der schon sehr alt ist und dass sie zu Hause einen großen Garten haben, mit Teich sogar. Ich hoffe nämlich, dass Antonia es fröhlicher erzählen kann als ihre Mutter.
»Ich muss arbeiten«, sagte Antonias Mutter und es klang wie eine Entschuldigung. »Antonia denkt, dass nur Lehrer arbeiten, wenn sie in die Schule geht, alle anderen haben frei, sind frei. Sie versteht das alles nicht, ich kann mich doch nicht immer um sie kümmern, sie ist so ein schwieriges Kind.« Ich nickte nur, die ganze Zeit, außer, wenn sie mir Geld geben wollte.
Ihre Mutter ist bestimmt ein bisschen enttäuscht, hat die ganze Zeit, über ein Jahr lang, Gegenliebe erhofft, weil das doch alles einfacher macht.
»Ich arbeite nicht wegen des Geldes, davon habe ich genug«, sagt sie. »Ich bin Malerin, ich male gerne, sehr gerne.«
Und wenn sie eines Tages ein Porträt von Antonia malen, dann vergessen Sie ihr Schweigen nicht! Das Schweigen muss auch mit aufs Bild! Ich denke das nur, keine Angst.
Natürlich weinte sie, sie liebt ihre adoptierte Tochter und ist ein bisschen auch die echte Mutter. Sie weinte noch mehr, als ich das Geld wieder auf den Tisch legte. Geld, in Scheine eingewickelt. Antonia war in ihrem Zimmer und ich sagte, das reiche nicht und sie sei viel mehr wert. Ich sage das oft, nur immer zur Falschen.
Mein Blick fiel in den Garten, er ist wirklich groß, nur der Teich ist zu klein, man kann das andere Ufer sehen.
Plötzlich springt die Schule hervor, zwischen den vielen Bäumen am Straßenrand. Gut, dass unsere Schulen nebeneinander liegen, dann sehe ich, ob du auch wirklich dahin gehst, Antonia. »Pass auf ...«, hat deine Mutter gesagt, »... pass auf, dass sie nicht wieder abhaut.«
Sie hat mir von deinen hundert Fluchten erzählt. Davon, dass du hundert Mal weggelaufen bist. In den Garten, weg von zu Hause. Nur in den Garten, hat deine Mutter gesagt, aber du warst viel weiter weg. Du warst am anderen Ufer, stimmt’s? Hundert kleine Tode bist du da gestorben, hast auf irgendeine Mutter gewartet, hundert Mal hast du dich selbst ein bisschen verletzt und deine Adoptivmutter, weil du immer abhaust, wenn sie das gemeinsame Schweigen bricht und du antworten musst. Und hundert Mal bist du zurückgekehrt, du denkst vielleicht Mutter hat es nicht gemerkt, aber du weißt es nicht. Und ich glaube, wenn du mich das fragen würdest, dann würde ich ganz still werden.
Und wieder fange ich an, mit dir zu reden. Wie so oft. Nur in Gedanken, alles nur in meinem Kopf. Weil ich dich so sehr mag, Antonia, und weil ich dich besser verstehe, als du vielleicht denkst. Weil du so still bist, dass ich mich selbst nerve, wenn ich nur ein einziges Wort sage.
Du hast Fragen und ich habe Antworten, die so gar nicht passen wollen. Vielleicht liegt es ja daran, dass man deine Fragen gar nicht beantworten kann.
Ich sehe, dass deine Schmetterlingshände nach der Schultasche greifen, die Schule hat uns erwischt, erschrocken hält der Bus.
Aber dieses Mal ist alles anders. Die Türen gehen mit einem Zischen auf, ich zucke zusammen, du lächelst nicht. Alle stehen auf, sicherlich ist da jetzt Lärm, aber ich höre ihn nicht. Ich bleibe einfach sitzen.
Ich habe nur noch eine einzige Antwort für dich. Sie passt wieder nicht zur Frage, aber sie wird dir trotzdem gefallen.
Du hast Flügel aus Glas, Antonia. Deshalb fliegst du nicht. Aber warte noch eine Weile. Ich zeige es dir.
Du siehst mich erstaunt an, erst jetzt weiß ich, dass deine Augen wirklich funktionieren. Du siehst mich zum ersten Mal an. Bestimmt ist dir egal, wie ich aussehe, du wunderst dich nur, dass ich die Wächterverkleidung abgelegt habe. Deine Schultasche sinkt langsam wieder zu Boden, die meisten sind schon ausgestiegen.
Du lässt die Schultasche los, siehst zur Schule und tust mir weh, weil ich unsicher werde.
Ich erschrecke wieder, als der Bus losfährt, doch nun aus einem anderen Grund. Aber jetzt siehst du mich an. Und du lächelst.
Wir steigen aus, der Busfahrer sagt »Endstation« und du denkst »Neuanfang«.
Es nieselt leicht und der Wind ist angenehm auf der Haut und zwischen den Haaren.
Da ist ein breiter Platz neben der Straße, er endet an einem Geländer aus Stein. Wir schlendern dorthin und stützen die Ellenbogen darauf.
Du siehst zu mir herüber und lächelst wieder, Danke soll es heißen. Ich sehe, dass du einen dunklen Zahn hast, der längst abgestorben ist und irgendwie, irgendwie macht er dein Danke schöner. Ich nicke, will auch nichts sagen.
Du bückst dich und öffnest deine Schultasche. Ich blicke nach vorne, wir haben eine schöne Aussicht hier. Unter uns stehen Stühle eines Restaurants und da ganz hinten fließt der Fluss.
Du holst etwas aus deiner Tasche hervor, ganz vorsichtig und ich sehe sofort, dass es dein Wellensittich ist. Ganz sanft hältst du ihn fest und zeigst ihn mir. Sein gelbes Gefieder ist zerzaust, er schaut sich verwirrt um.
»Da ist wohl ein Sonnenstrahl an ihm hängengeblieben«, meine ich nur, was soll ich sonst sagen? »Wie heißt er?«
Du hältst mir den Wellensittich hin, ich soll ihn nehmen. Er windet sich und fast wäre er weggeflogen, mit seinen echten Flügeln. Du schreibst mit grüner Kreide auf den Stein:
»Ich habe Angst, dass er stirbt. Ich lasse ihn frei. Er ist ein Quetzal.«
Später habe ich zu Hause in einem Buch nachgeschaut. Der Quetzal war bei den Mayas der Vogel der Freiheit. Weil er in Gefangenschaft immer starb.
Du nimmst ihn mir wieder ab und gibst ihm einen Kuss auf den Schnabel. Dann wirfst du ihn in die Luft und ein paar Federn regnen, dann hebt er ab, wie der Splitter eines alten Sonnenstrahls und fliegt davon. Du siehst ihm nach und es tut mir Leid, dass ich dich jetzt störe.
»Du hast Flügel aus Glas, Antonia. Du willst fliegen und kannst es nicht. Und wenn du es tust, machst du alles kaputt.«
Ich glaube, ich habe ein bisschen gelogen, vorhin. Unser Schweigen ist meine eigene Sprache. Ich muss sie dir nur übersetzen.
Doch du hast längst verstanden, lächelst immer wieder mit deinem dunklen Zahn und ich will dich in den Arm nehmen, aber da sind die Glasflügel, die man nicht berühren darf.
Ich bin dennoch glücklich, weil ich weiß, dass du es auch warst, als du den Vogel losgelassen hast. Du dachtest vielleicht, er nimmt dich mit, hm?
Doch du hast trotzdem gute Laune, bist redsam still, als wir den letzten Bus nach Hause nehmen.
»Aber sag meinen Eltern nichts, okay?«, flüstere ich dir ins Ohr, als wir aussteigen. Du schaust mich an und nickst, mit einem Lächeln im Gesicht. Du drehst dich um und gehst zu deiner Mutter zurück. Du hast wieder Boden unter deinen Füßen, nachdem du heute ein kleines bisschen abgehoben warst. Mit deinen Flügeln aus Glas.
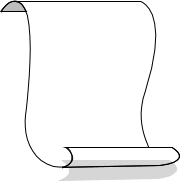 |